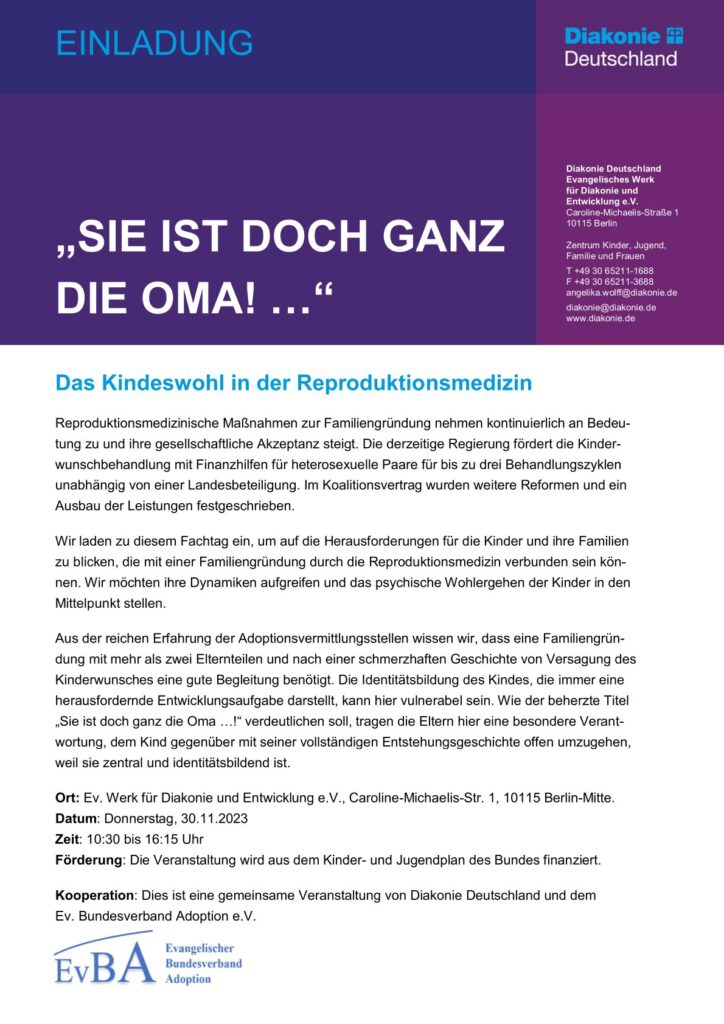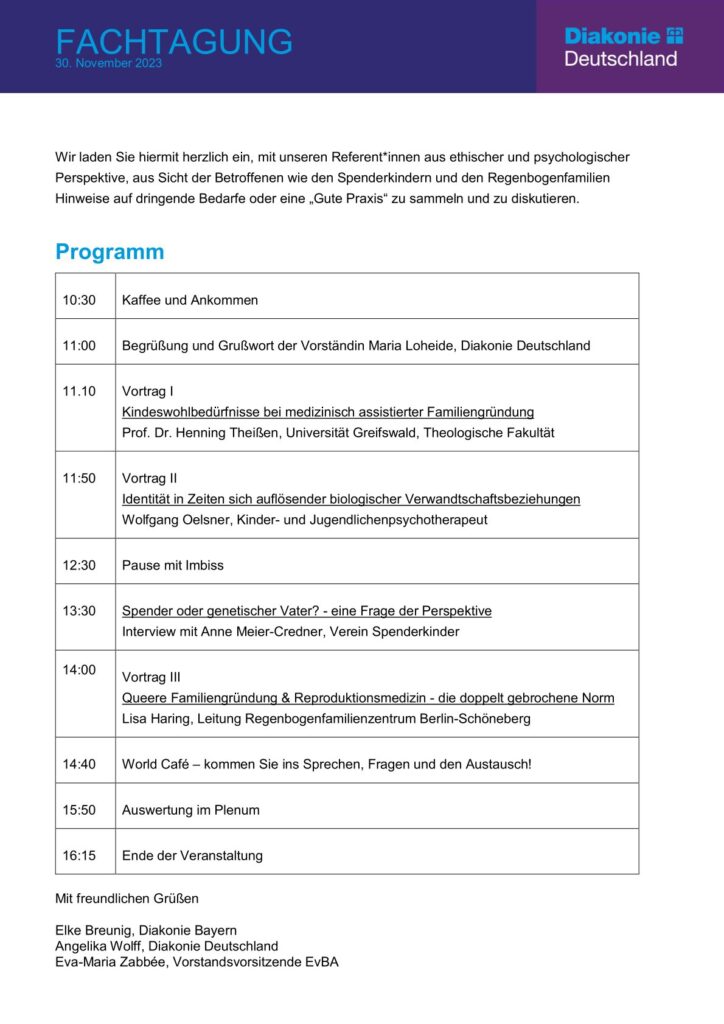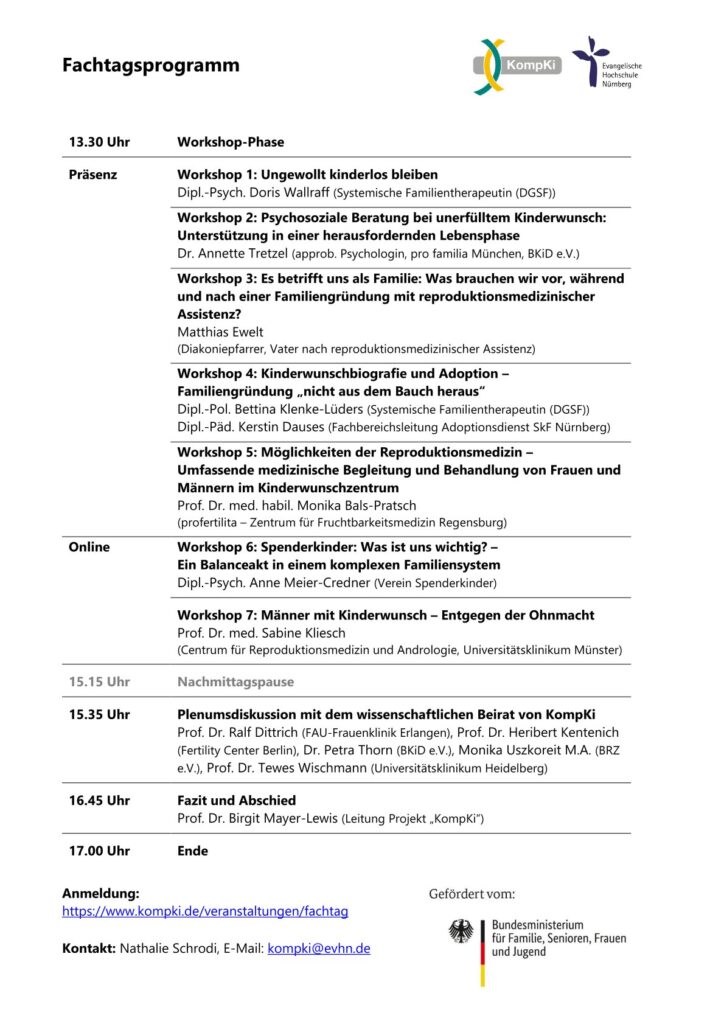Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat am 7. September 2023 in dem Fall Gauvin-Fournis and Silliau v. France (application
no. 21424/16; Urteil bisher nur auf Französisch) die erste Entscheidung zu den Rechten von Spenderkindern auf Kenntnis ihrer Abstammung getroffen. Es hat dabei bestätigt, dass das Recht auf Privatsphäre aus Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) grundsätzlich auch das Recht beinhaltet, Informationen über die Identität der Elternteile zu erhalten, aber im Ergebnis einen Verstoß der derzeitigen Rechtslage in Frankreich gegen die EMRK verneint.
Die französische Rechtslage sah von 1994 bis 2022 eine fast absolute Anonymität für Personen vor, die Samen oder Eizellen „gespendet“ haben. Ausnahmen gab es nur für den Zugriff von Ärzten bei einer medizinische Notwendigkeit oder wenn eine ernsthafte genetische Anomalie diagnostiziert wurde. Spenderinnen konnten noch nicht einmal freiwillig auf ihre Anonymität verzichten. Am 2. August 2021 änderte Frankreich sein Bioethik Gesetz (während des bereits laufenden EGMR-Verfahrens). Die Änderungen traten am 1. September 2022 in Kraft. Seitdem haben Spenderkinder eigentlich das Recht, die Identität ihrer genetischen Elternteile zu erfahren. Bis zum 31. März 2025 ist es jedoch weiterhin zulässig, unter der alten Rechtslage gespendete Samen, Eizellen und Embryonen zu verwenden. Daher haben eigentlich erst ab dem 31. März 2025 gezeugte Kinder das Recht, mit Volljährigkeit die Identität ihrer genetischen Elternteile zu erfahren. Für Spenderkinder, die wie die Kläger*innen des Verfahrens vor dem 31. März 2025 gezeugt wurden, gilt das nur, wenn der Spender oder die Spenderin zustimmen – was aber voraussetzt, dass sie noch leben.
Der EGMR betonte in seiner Entscheidung, dass der französische Gesetzgeber die betroffenen Interessen und Rechte in einem informierten und schrittweisen Reflektionsprozess abgewogen habe, der auch öffentliche Konsultationen beinhaltet habe. Frankreich habe daher innerhalb seines zulässigen Einschätzungsspielraums gehandelt. Auch das von 1994 bis 2022 geltende Gesetz habe mit den Zugriffsmöglichkeiten von Ärzten Ausnahmen von der absoluten Anonymität der Spender vorgesehen. Dabei betonte das Gericht, dass es keinen klaren Konsens unter den Mitgliedsstaaten der EMRK zur Frage der Anonymität von Spenderinnen gebe, sondern lediglich einen gewissen Trend zur Aufhebung der Anonymität. In Bezug auf die seit 2022 geltende Rechtslage entschied der EGMR, dass Frankreich auch hier den zulässige Einschätzungsspielraum eingehalten habe, indem er den Zugang von Spenderkindern davon abhängig macht, dass die Spenderinnen zustimmen.
Es handelt sich um eine Kammerentscheidung durch sieben Richterinnen des EGMR, gegen die drei Monate nach Zustellung eine Verweisung an die große Kammer des EGMR beantragt werden kann. Wird ein solcher Antrag gestellt, entscheiden fünf Richterinnen, ob der Fall weiter untersucht werden soll.
Die Klägerin Audrey Gauvin-Fournis und der Kläger Clément Silliau
Erste Klägerin ist die 1980 geborene französische Juristin Audrey Kermalvezen (geb. Gauvin-Fournis). Sie engagiert sich für die Rechte von Spenderkindern in Frankreich und hat zusammen mit ihrem Ehemann Arthur Kermalvezen, ebenfalls ein Spenderkind, die Organisation Origines gegründet. Über die Praxis von Samenspenden in Frankreich hat sie im Jahr 2014 das Buch: „Mes origines : une affaire d’État“ (Meine Herkunft – eine Staatsaffaire) veröffentlicht.1
In den Jahren 2010 bis 2016 klagte sie über mehrere Instanzen vergeblich gegen die staatlich organisierten Fortpflanzungskliniken CECOS auf Erhalt von nicht-identifizierende Informationen über ihren Spender und auf Auskunft ob ihr Bruder und sie den selben Spender hatten. Außerdem forderte sie, dass die Verwaltung ihren Spender kontaktiert, um ihn zu fragen, ob er weiterhin anonym bleiben möchte. Nach Erschöpfung des innerstaatlichen französischen Rechtswegs erhob sie im Jahr 2016 Klage beim EGMR. Für die Klage hatte sie mit einer Spendenkampagne um Unterstützung gebeten, auf die auch der Verein Spenderkinder aufmerksam gemacht hat.
Zweiter Kläger ist der 1989 geborene Clément Silliau, der im Alter von 17 Jahren von seiner Entstehungsweise erfuhr und die gleichen Anträge wie Audrey stellte.
Sieben Jahre nach Einreichung der Klage, während der das französische Bioethik-Gesetz geändert wurde, erfolgte nun die Entscheidung der Kammer.
Bewertung
Es handelt sich um das erste Urteil des EGMR zu Spenderkindern. Die vorherigen Urteile des EGMR betraf keine Fälle künstlicher Befruchtung, sondern anonyme Geburten, Adoptionen und so genannte Kuckuckskinder.
Im Jahr 2003 entschied der EGMR im Verfahren Odièvre vs. France,2, dass die in Frankreich vorgesehene Möglichkeit einer Frau, ihr Kind anonym zur Welt zu bringen, nicht gegen Artikel 8 der EMRK verstößt. Die französische Gesetzgebung verfolge mit der Möglichkeit der anonymen Geburt das Ziel, das Recht auf Leben von Mutter und Kind zu schützen, um Abtreibungen und Aussetzungen zu verhindern. Außerdem hatte Frankreich gerade neue Gesetze verabschiedet, wonach anonym adoptierte Menschen ihre Geburtsmutter durch eine zwischengeschaltete Institution fragen konnten, ob sie auf ihre Anonymität verzichten möchte. Zuletzt hatte die Klägerin Pascale Odièvre nicht identifizierende Informationen über ihre genetischen Eltern (ohne deren Zustimmung) und Geschwister erhalten, die ihr ermöglichten, einige ihrer Wurzeln zurückzuverfolgen.
Anders entschied der EGMR im Jahr 2012 im Fall Godelli vs. Italy3 für die damalige Praxis der anonymen Geburt in Italien. Das Gericht sah Artikel 8 EMRK als verletzt, weil die Klägerin Anita Godelli keinerlei Zugang zu Informationen über ihre Mutter und ihre Geburtsfamilie hatte. Der Antrag der Klägerin auf Erhalt von Informationen wurde vollumfänglich abgelehnt, ohne die widerstreitenden Interessen abzuwägen. Das italienische Gesetz versuche nicht, eine Balance zu finden zwischen den widerstreitenden Rechten der Klägerin, mehr über ihre Abstammung zu erfahren, und denen der Mutter, anonym zu bleiben, sondern entscheide sich ohne Abwägung für die Anonymität.
Bei dem jetzigen Fall gibt es eine deutliche Parallele zum Fall Odièvre: auch hier hatte der französische Gesetzgeber ebenfalls während eines EGMR Verfahrens die Rechtslage so geändert, dass die Mutter zumindest kontaktiert und gefragt werden musste, ob sie auf ihre Anonymität verzichten möchte. Es erscheint also sehr gut möglich, dass die Klage auch hier den französischen Staat überhaupt erst dazu bewegt hat, die Rechtslage zu ändern. Das ist natürlich positiv, denn dass der Spender kontaktiert wird und entscheiden muss, ob er auf seine Anonymität verzichten möchte, ist besser als eine absolute Anonymität. Beim Fall Odièvre hatte die Klägerin allerdings zumindest nicht identifizierende Informationen über ihre Familie erhalten. Solche Informationen haben Audrey Kermalvezen und Clément Silliau nicht erhalten.
Der EGMR hätte anders entscheiden können: Bei anonymen Geburten und Adoptionen muss der Schutz des Rechts auf Leben stärker berücksichtigt werden – weil verhindert werden soll, dass die Mutter eine Abtreibung vornimmt oder das Kind aussetzt. Dieses Recht ist bei Samen- und Eizellspenden nicht betroffen. Es handelt sich um geplante Schwangerschaften, zum Zeitpunkt der Spende existiert das Kind noch nicht. Auch verwundert etwas, dass der EGMR einen gründlichen Konsultationsprozess im parlamentarischen Verfahren ausreichen lässt. Ein solcher Prozess stellt nicht unbedingt sicher, dass die Menschenrechte der beteiligten angemessen berücksichtigt werden.
Bei der Entscheidung des EGMR muss man berücksichtigen, dass die EMRK (nur) einen menschenrechtlichen Mindeststandard für alle Vertragsstaaten vorsieht. Dabei berücksichtigt er meistens, was der Rechtslage in der Mehrzahl der Mitgliedsstaaten entspricht. Daher bezieht sich der EGMR auch darauf, dass es zur Frage der Anonymität von Spendern zwar einen Trend zu mehr Offenheit gibt, aber noch keinen Konsens. So hat der Europarat im Jahr 2022 eine Vergleichsstudie veröffentlicht zu dem Recht von Spenderkindern auf Informationen über ihre Abstammung (Comparative Study on access of persons conceived by gamete donation to information on their origins), in dem eine Empfehlung des Europarates angeregt wurde, dass die Mitgliedsstaaten einen Mechanismus etablieren sollen um das Recht auf Informationen sicherzustellen. Trotzdem hinterlässt es ein bitteres Gefühl, dass die Beachtung der Rechte von Spenderkindern von einem Konsens der Mitgliedstaaten über die Offenheit bei Samen- und Eizellspenden abhängig gemacht wird – unabhängig davon, ob die Rechte der entsprechenden Kinder überhaupt ausreichend gewahrt werden.
Positiv ist, dass der EGMR betont hat, dass Artikel 8 EMRK auf Spenderkinder anwendbar ist und sie grundsätzlich ein Recht auf Kenntnis ihrer genetischen Elternteile haben. Der deutliche Bezug auf die im Jahr 2022 geänderte Rechtslage in Frankreich legt nahe, dass die neuen Regelungen einen entscheidenden Anteil daran hatten, dass der EGMR kein Verstoß gegen die EMRK angenommen hat.
Es gibt daher deutliche Anzeichen dafür, dass der EGMR bei Vertragsstaaten der EMRK, die eine absolute Anonymität der Spender vorsehen, eine Verletzung von Artikel 8 annehmen könnte. Das betrifft vor allem Staaten wie z. B. Dänemark, Belgien, Spanien und Tschechien. Obwohl Großbritannien für seit dem 31. März 2005 gezeugte Kinder ein Recht auf Kenntnis ihrer genetischen Elternteile vorsieht, gilt dies für zuvor gezeugte Kinder nur, wenn der Spender oder die Spenderin auf seine Anonymität verzichtet hat – was er oder sie von sich aus tun muss.
Reaktionen
Audrey Kermalvezen äußerte sich kurz vor dem Urteil weiterhin hoffnungsvoll zu ihrem 14 Jahre dauernden Verfahren, da die Änderungen des französischen Rechts nichts an ihrer Situation geändert hatten:
„Ich hoffe, dass den Richtern klar wird, wie unzureichend das kürzlich von Frankreich eingeführte System ist. Die einzige Information für mich, die ich nach fast 14 Jahren Verfahren, im März 2023, auf legalem Wege erhielt, war, dass mein Spender gestorben ist. Daher werde ich niemals das Recht haben, seine Identität zu erfahren. Ich werde auch niemals Zugriff auf andere sogenannte nicht identifizierende Informationen haben, da der französische Staat beschlossen hat, deren Übermittlung von der Zustimmung des Spenders abhängig zu machen!
Daher erfahre ich zum Beispiel nie die Krankengeschichte meines Spenders, obwohl diese in seiner Akte bei der Samenbank erfasst ist.
Konkret habe ich kein Recht darauf, zu erfahren
als er starb,
noch woran,
ob er Kinder hätte,
was seine Krankengeschichte ist,
wie er aussah,
wer er war…
Ich habe keine Informationen über meine leiblichen Geschwister. Ich habe kein Recht zu wissen, wie viele Halbbrüder und Halbschwestern ich in der Natur habe oder wer sie sind …
auch nicht, wenn mein Bruder und ich mit derselben Spenderin gezeugt wurden. Zur Erinnerung: Die Verwendung eines DNA-Tests zur Feststellung der eigenen Herkunft ist in Frankreich strafbar (zwischen 3.750 Euro Geldstrafe und bis zu 30.000 Euro Geldstrafe und 2 Jahre Gefängnis wenn dadurch ein anonymer Spender identifiziert werden kann).“
Nach dem Urteil äußerte sie, dass es ein bitteres Gefühl bei ihr hinterlasse und dass das Urteil von vorherigen Entscheidungen zu Artikel 8 EMRK abweiche. Sie deutete an, dass sie eine Verweisung zur Großen Kammer beantragen wird. Außerdem wies sie darauf hin, dass Staaten wie Schweden anonyme Spenden schon im Jahr 1984 verboten hätten, das Vereinigte Königreich im Jahr 2003. Daher sei der Trend zu mehr Offenheit in Bezug auf die genetische Abstammung nicht so neu, wie der EGMR in seinem Urteil behauptet habe.
Ausblick: Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende
Jedes Spenderkind wird die Trauer und das Gefühl, nicht fair behandelt worden zu sein, nachvollziehen können. Audrey war als Anwältin die Erfolgschancen ihres Verfahrens von Anfang an bewusst und sie hoffte auf ein positives Ergebnis – dass sie und Clément dies auf sich genommen haben und damit versucht haben, für die Rechte aller Spenderkinder in Europa zu kämpfen, ist bewundernswert.
Dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Der Trend zu mehr Offenheit ist da in Europa: es gibt immer mehr Staaten, die sich entscheiden die Rechte von Spenderkindern auf Kenntnis ihrer Abstammung zu schützen. Auch wenn die Rechtslage selten perfekt ist, kann sie weiter verbessert werden: es handelt sich um einen fortschreitenden Prozess. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon, und der Weg über Klagen und strategische Prozessführung ist nur ein möglicher Weg zum Erfolg. Wichtig wird weiterhin sein, dass Spenderkinder sich zusammenschließen, von ihren Erfahrungen berichten und eine Änderung der Rechtslage fordern.
Vielleicht ist es aber auch noch nicht das Ende: Audrey Kermalvezen hat zumindest angedeutet, dass sie eine Verweisung an die große Kammer des EGMR beantragen wird.